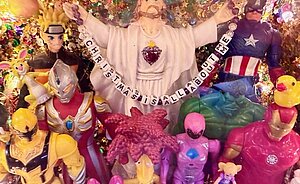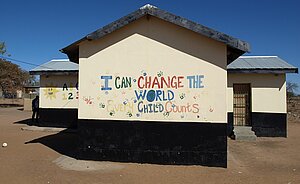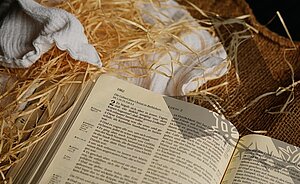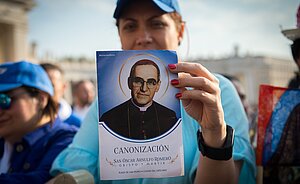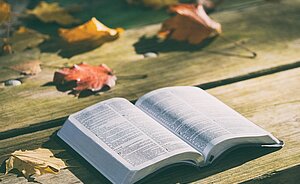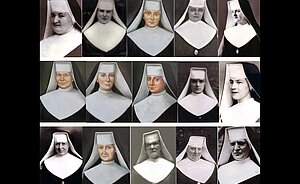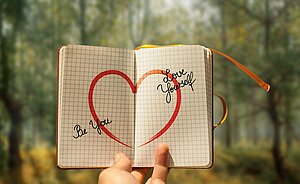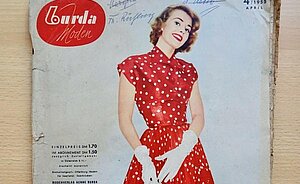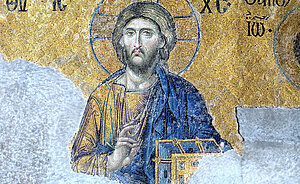Beiträge auf: wdr5
Das Geistliche Wort | 16.11.2025 | 08:40 Uhr
DIESER BEITRAG ENTHÄLT MUSIK, DAHER FINDEN SIE HIER AUS RECHTLICHEN GRÜNDEN KEIN AUDIO.
100 Jahre „Volkstrauertag“
Musik 1: On the Nature of Daylight
Komponist/Interpret: Max Richter, Album: The Blue Notebooks, Deutsche Grammophon 2004; LC: 49298
Autorin: Es ist der 14. November 1993, Volkstrauertag. Ich stehe mit tausenden von Menschen „Unter den Linden“ in Berlin, nahe der Neuen Wache.
Nach dem Fall der Mauer hat die Regierung die Neue Wache zur zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erklärt. Es gab damals Kontroversen um die Wahl des Ortes und die Ausgestaltung der Neuen Wache, denn in der Mitte steht jetzt eine stark vergrößerte Bronzeskulptur von Käthe Kollwitz: „Mutter mit totem Sohn“. Die etwa 1,60m hohe Skulptur zeigt den toten Sohn, der zwischen den Beinen der Mutter am Boden kauert wie ein Kind, das Schutz sucht. Er wird dabei ganz von der Mutter umfangen, sie selbst stützt ihren Kopf auf ihren rechten Arm, wirkt eher nachdenklich als klagend. Die Plastik ist Kollwitz‘ Sohn Peter gewidmet, der im ersten Weltkrieg gefallenen ist.
Autorin: Volkstrauertag 1993: Wird die Wahl des Ortes und des Kunstwerkes den unterschiedlichen Opfergruppen gerecht? Sind die Opfer, derer hier gedacht wird, nicht auch Täter? So die Bedenken damals.
Ich stehe also mit tausenden von Menschen „Unter den Linden“ und warte auf die Ehrengäste und die Zeremonie. Es regnet in Strömen. Die Stimmung ist gereizt.
Neben mir steht eine Traube von jungen Menschen, die mit „Buhrufen“ und Pfiffen laut werden, als der Bundespräsident, Richard von Weizäcker, vorfährt.
Hinter Ihnen stehen auf der Bank einer Bushaltestelle zwei ältere Paare. Ihnen scheint die Zeremonie wichtig zu sein. Trotz ihres Alters sind sie auf die Bank der Bushaltestelle gestiegen, um besser sehen zu können.
Der Protest aus den Reihen vor ihnen stört sie. Es wird laut zwischen den beiden Gruppen. Plötzlich nimmt einer der älteren Herren seinen Regenschirm und schlägt damit einem der jungen Männer heftig auf den Kopf. Ein Wort gibt das andere, der Streit eskaliert. Der junge Mann muss notärztlich versorgt werden.
Dies ist der erste Volkstrauertag, an den ich mich bewusst erinnern kann. Eine Dreiundzwanzigjährige, die zu verstehen versucht, warum kollektives Trauern in Deutschland so schwer ist.
Musik 3 = Musik 11993: Wir sind dem Frieden nähergekommen. Deutschland ist nach der friedlichen Revolution in der DDR wiedervereint. In Ost und West wird abgerüstet. Freiheit und Demokratie breiten sich aus. Menschen und Völker in Europa rücken näher zusammen. Der Frieden scheint weltweit auf dem Vormarsch.
Und zugleich haut vor der Neuen Wache einer dem anderen auf den Kopf.
Viele Volkstrauertage habe ich seitdem bewusst erlebt. Die meisten davon als Pfarrerin auf den Friedhöfen in meiner Gemeinde. Mit dabei: der katholische Kollege, der Bürgermeister, die Vereine des Dorfes. Gemeinsam gedenken wir und versuchen den verschiedenen Opfer-Perspektiven gerecht zu werden: den Opfern von Gewalt und Krieg, den Kindern, Frauen und Männern aller Nationen. Meist ist die Musik zu laut und die Worte zu groß. Vermutlich um diese Unsicherheit zu kaschieren, wie denn am besten miteinander zu trauern und zu gedenken ist. Haben wir an alle gedacht, wenn wir gemeinsam gedenken? Haben wir die richtigen Worte gefunden? Den richtigen Ton getroffen?
Wem gehören unsere Toten? Und wie sollen wir ihrer gedenken? Meist vereinnahmen wir die Toten mit unserer Trauer, denn es geht in unserer Trauer ja immer auch um uns. Um die, die mit der Trauer leben müssen.
Musik 4: Near Light
Komponist/Interpret: Olafur Arnalds, Album: Living Room Songs, Erased Tapes 2011;
LC: 15952
Autorin: Heute ist Volkstrauertag. Landauf, landab kommen heute Menschen an sogenannten Ehrenmälern auf den Friedhöfen und anderen Orten zusammen, um sich zu erinnern und sich diese Erinnerung zur Mahnung werden zu lassen.
Die Motive und Beweggründe für dieses Zusammenkommen haben sich im Laufe der Geschichte verändert.
Wollte man vor 100 Jahren mit dem ersten Volkstrauertag an die im Krieg getöteten Soldaten des Ersten Weltkrieges erinnern; so geht es heute um alle Opfer von Gewalt und Krieg, Kinder, Frauen und Männer aller Völker, die in den Kriegen und durch Gewaltherrschaft zu Tode gekommen sind.
Der erste Volkstrauertag fand 1925 statt. Damals noch nicht im November, sondern im März. Mit Flaggen auf Halbmast und einem Umzug in Berlin.
Einen „Volkstrauertag“ einzuführen – als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des ersten Weltkriegs, erfolgte auf Vorschlag des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.
Als Datum wurde der Sonntag Reminiscere, der fünfte Sonntag vor Ostern, festgelegt.
Es waren damals – in der Zeit der Weimarer Republik – vor allem Menschen aus dem nationalkonservativen Milieu, die sich aktiv an den Gedenkfeiern beteiligten. Kommunisten und zunehmend auch Linksliberale kritisierten den neuen Gedenktag als kriegsverherrlichend und gingen auf Distanz.
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde der Gedenktag 1934 zum „Heldengedenktag“ umfunktioniert – nicht mehr Trauer, sondern heroische Verehrung standen jetzt im Vordergrund.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der ursprüngliche Gedanke des Volkstrauertages in Ost- und Westdeutschland mit jeweils unterschiedlichen Akzentuierungen neu belebt.
In der Bundesrepublik findet 1950 die erste zentrale Veranstaltung im Bundestag in Bonn statt.
In der DDR ersetzt der Internationale Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieg den Volkstrauertag.
In Abstimmung mit den beiden großen Kirchen wird der Volkstrauertag in Westdeutschland Anfang der 1950er an das Ende des Kirchenjahres auf den vorletzten Sonntag vor der Adventszeit verlegt. Die zeitliche Nähe zu Allerheiligen und zum Ewigkeitssonntag lassen jetzt christliche Bezüge zu den Themen Tod, Zeit und Ewigkeit in den Vordergrund treten.
Nach der Wiedervereinigung findet jetzt die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Plenarsaal des Deutschen Bundestages statt. Das Totengedenken ist Aufgabe des Bundespräsidenten/der Bundespräsidentin. Es gibt einen festgelegten, wiederkehrenden Text. Darin heißt es u.a.:
Sprecher 1:
Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker. (…) Wir trauern mit allen, die Leid tragen um die Toten, und teilen ihren Schmerz.
Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.
Musik 5: Spiegel im Spiegel
Komponist/Interpret: Arvo Pärt, , Album: Angele Dubeau & La Pieta, Analekta 2003, LC: 26657
Autorin: Der Volkstrauertag ist kein christlicher Feiertag. Warum also beteiligen sich die christlichen Kirchen in Deutschland traditionell an der Gestaltung dieses Tages?
Warum gehen so viele Pfarrerinnen und Pfarrer an diesem Tag mit auf die Friedhöfe und an die Gedenkstätten, gestalten die Trauer- und Erinnerungsrituale gemeinsam mit Akteuren der Zivilgesellschaft?
Offenbar wird den christlichen Kirchen immer noch Verantwortung zugesprochen, wenn es darum geht, tiefgreifende gesellschaftliche Umbrüche zu gestalten. Viele sagen: Die Kirchen können das. Trost spenden, ein Ritual anbieten, das trägt.
Steht die Gesellschaft unter Schock nach einem Flugzeugabsturz oder einem Terroranschlag, versammeln sich Vertreter aus Politik und Gesellschaft, Kirchen und Religionsgemeinschaften, um mit den Betroffenen zu trauern und Halt anzubieten. So gilt es auch für diesen festen Gedenktag im Jahr, den Volkstrauertag.
Aus der Tradition unseres Glaubens heraus bringen wir Christinnen und Christen viel mit.
Wir glauben: Der Tod ist nicht das Ende. Wir glauben: Gott ist treu und uns Menschen zugewandt. Wir glauben: Von eigener Schuld und Verantwortung reden zu können, ist der erste Schritt zu heilsamer Versöhnung. Wir glauben: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.
Musik 6: Fragile
Komposition: Sting; Interpret: Nils Landgren; Album: Sentimental Journey; Label: ACT Music; LC: 07644
Autorin: Der christliche Glaube nährt sich von den biblischen Texten. Von Kriegen und der Sehnsucht nach Frieden ist dort erschreckend viel die Rede.
Sprecher 2:
Ach, wie einsam ist sie geworden, die Stadt, die voller Menschen war. Wie eine Witwe ist sie geworden. Sie weint bitterlich in der Nacht. Niemand ist da, der sie tröstet, kein einziger unter ihren Freunden.
Autorin: So beginnt das erste der biblischen Klagelieder. Worte voller Schmerz, voller Wehmut über das, was verloren ist: Jerusalem ist zerstört. Die Heimat liegt in Trümmern. Die Ordnung des Lebens ist zerbrochen.
Die Klagelieder in der Bibel machen etwas Ungewöhnliches: Sie geben Raum für kollektive Trauer. Für die Stimme eines Volkes, das gemeinsam weint. Kein stilles Weinen einzelner, nicht das laute Jammern, das andere eher abschreckt – sondern eine liturgische, poetische Form der Trauer. Sie zeigt: Manches Leid ist zu groß, um es allein zu tragen. Es braucht gemeinsame Worte, gemeinsame Stille, gemeinsame Tränen.
Und dann erwächst in den folgenden Klageliedern aus der tiefen Traurigkeit und Erschütterung die Erkenntnis der Trauernden: Dass es so gekommen ist, dass wir Krieg und Zerstörung beklagen, liegt auch in unserer Verantwortung. Wir haben nicht nach Gott gefragt und nicht nach unseren religiösen Überzeugungen gelebt. Wir haben Gottes Wort und Gebot aus dem Blick verloren.
Und aus dieser Erkenntnis entwickelt sich dann eine neue Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Kollektive Reue wird zur Hoffnung auf Zukunft. Die Trauer lähmt nicht länger, sondern wird zu einer geteilten Erfahrung, die verwandelt.
Sprecher 3:
Ja, Gottes Güte, hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er sich von neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß. Ich bekenne: „Der Herr ist alles für mich. Deshalb setze ich meine Hoffnung auf ihn.“ Der Herr ist gut zu dem, der auf ihn hofft; zu dem Menschen, der nach ihm fragt.
Autorin: Miteinander zu trauern, kann heilsam sein. Wenn wir den Schmerz des anderen teilen, miteinander auch kollektive Schuld und Versagen aushalten und gemeinsam nach einem Weg in die Zukunft suchen, dann heilen die Wunden und wir können uns dem Leben wieder zuwenden.
Musik 7: Metamorphosis Two
Komponist/Interpret: Philipp Glass, Album: Solo Piano, 1989 Sony BMG Music; LC: 13989
Autorin: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!“ Diesen Satz hat der Ökumenische Rat der Kirchen 1948, drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, formuliert. So wie es war, darf es nie wieder kommen. Mit dieser Haltung verbindet sich der friedensethische Auftrag, den Anfängen von Gewalt und Krieg zu wehren und angesichts von Konflikten rechtzeitig nach gewaltfreien Lösungen zu suchen.
Es sind die Worte Jesu aus der Bergpredigt „Liebet eure Feinde“ und die großen Utopien der Propheten, die hier Pate gestanden haben. Sätze, die naiv erscheinen und doch die Friedenspolitik in unserem Land geprägt haben:
Sprecher 4:
„Sie
werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen,
und ihre Spieße zu Sicheln.
Kein Volk wird mehr gegen das andere das Schwert erheben,
und sie werden den Krieg nicht mehr lernen.
Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen,
und niemand wird sie schrecken.“
Autorin: So heißt es beim Propheten Micha. Die Friedensbewegung in Ost- und Westdeutschland in den 1980er Jahren nutzte das Bild von den Schwertern, die zu Pflugscharen werden. Im Westen wurde damit gegen den Nato-Doppelbeschluss und eine weitere Aufrüstung protestiert. Im Osten führte die Friedensbewegung letztlich zur friedlichen Revolution.
Aktuell wird wieder in unserem Land diskutiert: Wieviel Aufrüstung brauchen wir? Und welchen Wehrdienst? Was dient letztlich dem Frieden?
Musik 8 = Musik 1Heute, 100 Jahre nach dem ersten Volkstrauertag, stehen wir erneut an einem historischen Schwellenmoment. Wir erleben Krieg in unserer Nähe, von Bedrohung und Abschreckung ist die Rede, von Wehrdienst und Verteidigungsbereitschaft. Und wieder müssen wir fragen: Was heißt das für uns als Gesellschaft? Was heißt das für uns als Christinnen und Christen?
Vielleicht ist der
wichtigste Beitrag, den wir an diesem Tag leisten können, dieser:
Dass wir uns berühren lassen vom Schmerz der anderen – auch wenn es unbequem
ist.
Dass wir uns verantwortlich fühlen – für das, was war, und das, was kommt.
Und dass wir den Mut nicht verlieren, vom Frieden zu sprechen, wo andere schon
wieder kriegstüchtig werden wollen.
Der Volkstrauertag ist
kein lauter Tag. Er ist kein Tag für Parolen.
Er ist ein Tag für das, was wichtig ist: Das Andenken an unsere Toten. Das
Mitfühlen mit den Leidenden. Und das gemeinsame Versprechen, dem Frieden eine
Zukunft zu geben.
Denn:
Gott ist an der Seite derer, die sich nicht abfinden.
Mit dem Unrecht nicht.
Mit dem Leid nicht.
Mit der Gewalt nicht.
Unsere Trauer ist bei
Gott gut aufgehoben.
Und unsere Hoffnung auch. Amen.
Aus Bonn grüßt Sie Ihre Pfarrerin Anne Kathrin Quaas.
Musik 10 = Musik 6
Quellen:
-
Klagelieder 1,
1-2 (Übersetzung Basisbibel): https://www.die-bibel.de/bibel/LU17,BB/LAM.1
-
Klagelieder 3,
22-25 (Übersetzung Basisbibel): https://www.die-bibel.de/bibel/LU17,BB/LAM.3
-
Totengedenken
(aktuelle Textfassung):
https://gedenkportal.volksbund.de/gedenktage/volkstrauertag/totengedenken
-
https://www.die-bibel.de/bibel/LU17,BB/MIC.4
Redaktion: Pfarrer Dr. Titus Reinmuth